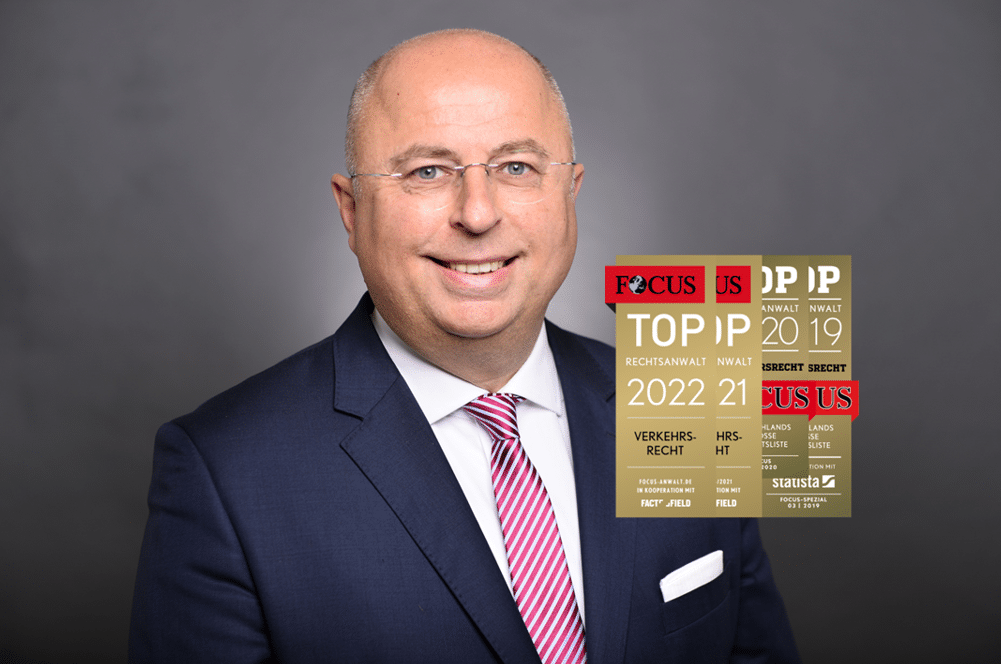Von Rechtsanwalt Gregor Samimi
zuletzt aktualisiert am 06.11.2025, 11:00 Uhr. 1.282 Wörter, 7 Minuten Lesezeit.
Es gibt Mandate, bei denen der Rechtsanwalt die Rollen tauscht: vom Vertreter zum Vertretenen, vom Berater zum Betroffenen. Was passiert also, wenn der Anwalt nach einem Verkehrsunfall seinen eigenen Schaden reguliert – und anschließend von der gegnerischen Versicherung die eigenen Gebühren ersetzt verlangt?
1. Einleitung
Lange galt das als Tabu, als juristische Selbstbedienung, allenfalls als berufsbedingte Kostenfrage mit einem Augenzwinkern. Doch das Landgericht Berlin hat mit Urteil vom 23. Juli 2025 (Az. 46 S 22/25) diesem Zögern ein Ende gesetzt. In präziser, fast eleganter Deutlichkeit entschied es:
„Auch ein Rechtsanwalt hat Anspruch auf Erstattung seiner Gebühren, wenn er seinen eigenen Fahrzeugschaden selbst reguliert.“
Ein Urteil, das den anwaltlichen Stolz ebenso beflügelt wie die juristische Diskussion – und das die Versicherer wohl weniger begeistert zur Kenntnis genommen haben dürften.
2. Der Fall – Wenn der Jurist zum Unfallopfer wird

Der Kläger, selbst Rechtsanwalt und offensichtlich kein Freund unnötiger Fremdmandate, hatte nach einem unverschuldeten Verkehrsunfall seinen Fahrzeugschaden bei der gegnerischen Haftpflichtversicherung angemeldet.
Er schrieb, mahnte, erinnerte – also tat das, was sonst andere für ihn tun würden. Dann verlangte er für diese Tätigkeit 745,40 € Anwaltskosten.
Die Versicherung winkte ab: Ein Anwalt könne sich doch selbst vertreten, ohne sich dafür zu bezahlen. Das Amtsgericht Mitte folgte zunächst dieser Linie – bis das Landgericht Berlin in der Berufung die Sache in deutlicher Klarheit und gebotener Ausführlichkeit geraderückte.
3. Das Urteil des Landgerichts Berlin – Der Anwalt ist kein Gratisdienstleister
Das Landgericht bejahte den Anspruch gemäß § 7 Abs. 1 StVG i.V.m. § 115 Abs. 1 Nr. 1 VVG. Die Begründung liest sich wie eine kleine Hommage an die anwaltliche Profession:
- Erforderlichkeit der anwaltlichen Tätigkeit:
Auch der Anwalt darf sich anwaltlich vertreten – selbst dann, wenn er zufällig die beste Person dafür ist. Der Schädiger kann nicht verlangen, dass der Geschädigte seine juristische Expertise „pro bono“ einsetzt, um den Versicherer zu entlasten.
- Kein einfach gelagerter Fall:
Verkehrsunfälle, so das Gericht, seien selten juristische Routine – auch dann nicht, wenn der Betroffene Fachanwalt für Verkehrsrecht ist. Wer jemals mit Kürzungen bei Nutzungsausfall, Reparaturdauer oder Wertminderung konfrontiert war, weiß: Einfach gelagert ist im Verkehrsrecht meist nur der Stau auf der Gegenspur.
- Praktische Zumutbarkeit:
Selbst der erfahrene Jurist darf vernünftigerweise bezweifeln, dass der Versicherer ohne anwaltliche Einwirkung zahlt. Das Gericht folgte dabei der Linie des BGH (NJW 2020, 144 Rn. 24) und stellte fest, dass bei Fahrzeugschäden regelmäßig juristische Streitfragen lauern, die ein Tätigwerden als Anwalt auch in eigener Sache erforderlich machen.
Das Ergebnis: Die Beklagte muss zahlen – und zwar voll. Kein Cent Rabatt auf anwaltliche Kompetenz.
4. Ein Vorläufer: Das Urteil des Amtsgerichts Mitte
Interessanterweise hatte das Amtsgericht Mitte von Berlin bereits zwei Jahre zuvor am 15.03.2023, Aktenzeichen 28 C 278/22 V, einen nahezu identischen Fall entschieden – allerdings zugunsten des klagenden Anwalts.
Richterin Hajek sah die Sache pragmatisch:
„Es gibt keinen rechtlichen Gesichtspunkt, der es vertretbar erscheinen ließe, dass der geschädigte Anwalt den Einsatz seiner beruflichen Arbeitskraft zugunsten des Schädigers umsonst leisten müsste.“
Das AG Mitte stützte sich in den Urteilsgründen auf die allgemeinen Grundsätze der §§ 7, 17 StVG, § 115 VVG und § 249 BGB: Der Geschädigte – auch wenn er Jurist ist – darf den Aufwand ersetzt verlangen, der zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich und zweckmäßig ist.
Dabei griff das Gericht einen charmanten Vergleich auf:
„Auch der Arzt, der seine eigene Wunde näht, oder der Kfz-Mechaniker, der sein eigenes Fahrzeug repariert, kann Ersatz der Kosten verlangen, die durch die Beauftragung eines Dritten entstanden wären.“
Mit anderen Worten: Juristische Selbsthilfe ist erlaubt, aber nicht umsonst.
5. Zusammenspiel der Entscheidungen – Berliner Linie mit Signalwirkung
Beide Berliner Gerichte sprechen im Kern dieselbe Sprache:
- Der Anwalt ist kein Selbstversorger auf Haftungsrechtsebene.
- Der Versicherer profitiert nicht von der Qualifikation des Geschädigten.
- Die anwaltliche Arbeit bleibt ein ersatzfähiger Aufwand – unabhängig davon, wer sie erbringt.
Diese Rechtsprechung stärkt das Selbstverständnis der Anwaltschaft und setzt zugleich ein wichtiges Zeichen gegen Versicherungslogik nach dem Motto: „Wer sich auskennt, kriegt weniger.“
6. Bedeutung für die Praxis
Für die Praxis der Unfallregulierung – insbesondere in Großstädten wie Berlin, wo Blechschäden und Paragrafen oft dicht beieinander liegen – bedeutet das:
- Selbstgeschädigte Anwälte dürfen ihre Gebühren in der üblichen Höhe geltend machen.
- Versicherer können sich nicht auf die „Selbstvertretung“ berufen, um Zahlungen zu kürzen.
- Kolleginnen und Kollegen sollten ihre eigene Arbeitszeit realistisch bewerten – juristische Expertise ist keine Gefälligkeit, sondern Arbeitsleistung.
Oder, etwas salopper gesagt: „Auch der Anwalt isst nicht von Luft, sondern von Gebührentatbeständen.“
7. Fazit – Ein Sieg der Vernunft (und der Systematik)
Das Landgericht Berlin hat mit Urteil vom 23. 07. 2025 (46 S 22/25) die Berliner Linie bestätigt und fortgeführt. Ein Rechtsanwalt, der seinen eigenen Unfallschaden reguliert, darf seine anwaltlichen Gebühren ersetzt verlangen – ganz so, als hätte er sich selbst beauftragt. Damit steht fest: Die anwaltliche Tätigkeit bleibt auch in eigener Sache eine berufliche Dienstleistung und kein Akt selbstloser Rechtsromantik.
Ein Urteil, das man mit einem leichten Schmunzeln lesen darf – und mit einem zufriedenen Kopfnicken beiseitelegt.
8. FAQ – Häufige Fragen zur Gebührenerstattung bei Selbstvertretung
1. Darf ein Rechtsanwalt seine eigenen Gebühren geltend machen, wenn er seinen Unfallschaden selbst reguliert?
Ja. Nach dem Urteil des Landgerichts Berlin (46 S 22/25) und des Amtsgerichts Mitte (28 C 278/22 V) kann auch ein Anwalt seine anwaltlichen Gebühren als Schadensposition geltend machen. Die Tätigkeit gilt als erforderlich im Sinne des § 249 BGB, weil ein vernünftiger Geschädigter – selbst mit Fachwissen – anwaltliche Unterstützung in Anspruch nehmen würde.
2. Gilt das auch bei einfach gelagerten Fällen?
Nur ausnahmsweise nicht. Wenn die Haftung und Schadenshöhe glasklar sind (z. B. reiner Parkrempler, Schadenshöhe gering, sofortige Regulierung), kann die Hinzuziehung eines Anwalts entbehrlich sein. Doch schon die Kommunikation mit Versicherern, die Bewertung einzelner Schadenspositionen und abweichende Regulierungspraxis führen dazu, dass ein Fall in der Regel nicht mehr „einfach“ ist.
3. Wie hoch sind die erstattungsfähigen Gebühren?
Die Höhe richtet sich nach dem Gegenstandswert des Schadens und der üblichen Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 VV RVG, zuzüglich Auslagenpauschale und ggf. Umsatzsteuer. Die Gerichte erkennen dabei dieselben Maßstäbe an, wie sie auch bei der Beauftragung eines Dritten gelten.
4. Muss der Anwalt eine formelle Mandatierung in eigener Sache vornehmen?
Nein, eine schriftliche Selbstmandatierung ist nicht erforderlich. Es genügt, dass der Anwalt nach außen hin als Rechtsanwalt auftritt, also z. B. im eigenen Namen ein Anschreiben oder eine Mahnung an die Versicherung richtet. Die Tätigkeit muss aber anwaltlich geprägt sein – bloßes Telefonieren mit der Versicherung reicht nicht.
5. Was, wenn die Versicherung die Zahlung der Anwaltsgebühren ablehnt?
Dann sollte der Anspruch – wie im Berliner Fall – gerichtlich geltend gemacht werden. Die Erfolgsaussichten stehen nach den aktuellen Entscheidungen sehr gut. Die Versicherung trägt bei Unterliegen auch die Kosten des Rechtsstreits, einschließlich der anwaltlichen Gebühren – was eine gewisse poetische Gerechtigkeit in sich trägt.
6. Hat die Entscheidung über Berlin hinaus Bedeutung?
Ja, eindeutig. Die Urteile haben Signalwirkung für die gesamte Bundesrepublik, da sie sich auf die gefestigte Rechtsprechung des BGH (NJW 2020, 144 Rn. 24 mwN) stützen. Andere Landgerichte dürften dem folgen, weil die Argumentation sowohl dogmatisch stringent als auch praxisgerecht ist.
7. Wie sollten sich Rechtsanwälte in vergleichbaren Fällen verhalten?
- Den eigenen Unfall wie einen Mandatsfall behandeln – mit Aktenzeichen, Schreiben, Fristen.
- Den Gegenstandswert und die Gebühr exakt nach RVG berechnen.
- Die Korrespondenz mit der Versicherung dokumentieren, um den anwaltlichen Charakter der Tätigkeit nachzuweisen.
Kurz gesagt: Professionalität zahlt sich aus.
9. Fazit (erneut auf den Punkt gebracht)
Mit den Urteilen des AG Mitte von Berlin (2023) und des Landgerichts Berlin (2025) haben die beiden Berliner Gerichte einmal mehr juristische Klarheit geschaffen: Der Rechtsanwalt bleibt auch dann Anwalt, wenn er selbst betroffen ist – und seine Arbeit ist kein Ehrenamt im Namen der Versicherungswirtschaft.
9. Weiterführende Informationen und Links
- Blogbeitrag: Vergütungserstattungsanspruch eines Anwalts nach einem Verkehrsunfall bei eigener Beauftragung bzw. Selbstvertretung gegenüber dem Versicherer, zum Urteil des Amtsgericht Mitte von Berlin vom 15.03.2023, Aktenzeichen 28 C 278/22 V.
- Das Urteil des Landgerichts Berlin wurde von dem Kollegen Herrn Rechtsanwalt Michael Riemer übersandt.
Rechtsanwalt Gregor Samimi ist Fachanwalt für Strafrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht und Fachanwalt für Versicherungsrecht in Berlin Steglitz-Zehlendorf. https://www.ra-samimi.de/