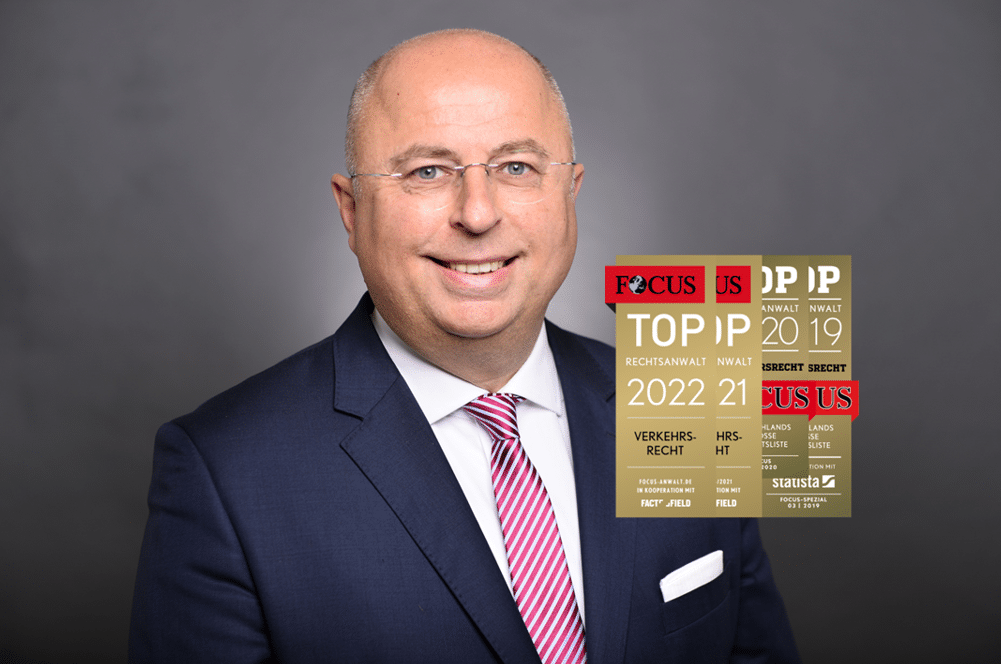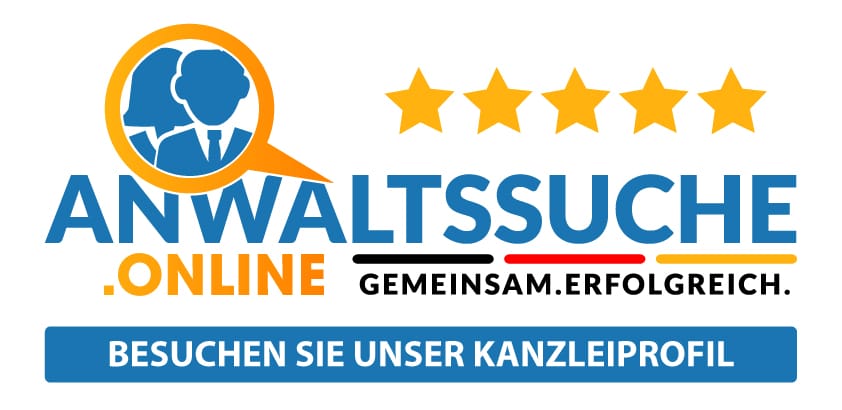Von Rechtsanwalt Gregor Samimi*, zuletzt aktualisiert am 05.11.2025, 17:40 Uhr. 2.064 Wörter, 11 Minuten Lesezeit.
Rechtsstaat light hinter Hochglanzversprechen der Rechtsschutzversicherer: Warum die geplante Ausweitung der Rechtsdienstleistungen durch Rechtsschutzversicherer den Rechtsuchenden teuer zu stehen kommen könnte
Zugang zum Recht – oder nur der Schein davon?
Die Herbsttagung der 96. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister in Leipzig könnte sich als ein Wendepunkt für die deutsche Rechtskultur erweisen. Der Beschlussvorschlag aus Bayern will Rechtsschutzversicherern die außergerichtliche Rechtsberatung und Vertretung ihrer Versicherungsnehmer eröffnen. Begründet wird das mit einem „niedrigschwelligen Zugang zum Recht“ und der Aussicht, die Justiz durch vorgerichtliche Lösungen zu entlasten.
Die Begründung klingt modern, pragmatisch und bürgernah – ein Hochglanzversprechen. Doch wer den Lack ankratzt, stößt schnell auf ernüchternde Realitäten: Das Vorhaben birgt die Gefahr, dass Rechtsschutzversicherer ihre ohnehin starke Marktstellung weiter ausbauen und dabei die anwaltliche Unabhängigkeit und den Verbraucherschutz aushöhlen.
Versicherer als Anwälte in eigener Sache
Der Kern des Problems ist altbekannt: Anwältinnen und Anwälte sind nach § 43a BRAO zur Unabhängigkeit verpflichtet und ausschließlich den Interessen ihrer Mandanten verpflichtet. Ihre Berufspflichten und ihre zivilrechtliche Haftung sichern dies ab.
Demgegenüber stehen Rechtsschutzversicherer, deren Geschäftsmodell nicht in der Durchsetzung fremder, sondern in der Begrenzung eigener Kosten besteht. Ihre wirtschaftliche Logik läuft diametral zu dem Anspruch des Rechtsuchenden, die beste statt die kostengünstigste Lösung zu erhalten.
Die geplanten organisatorischen „Chinese Walls“ innerhalb der Versicherer sind dabei nicht mehr als juristische Dekoration. Wer die Doppelrolle als Kostenträger und vermeintlicher Berater in einer Hand bündelt, schafft einen strukturellen Dauerinteressenkonflikt.
Ein Blick zurück: Anwaltliche Erfahrungen aus dem RSV-Blog
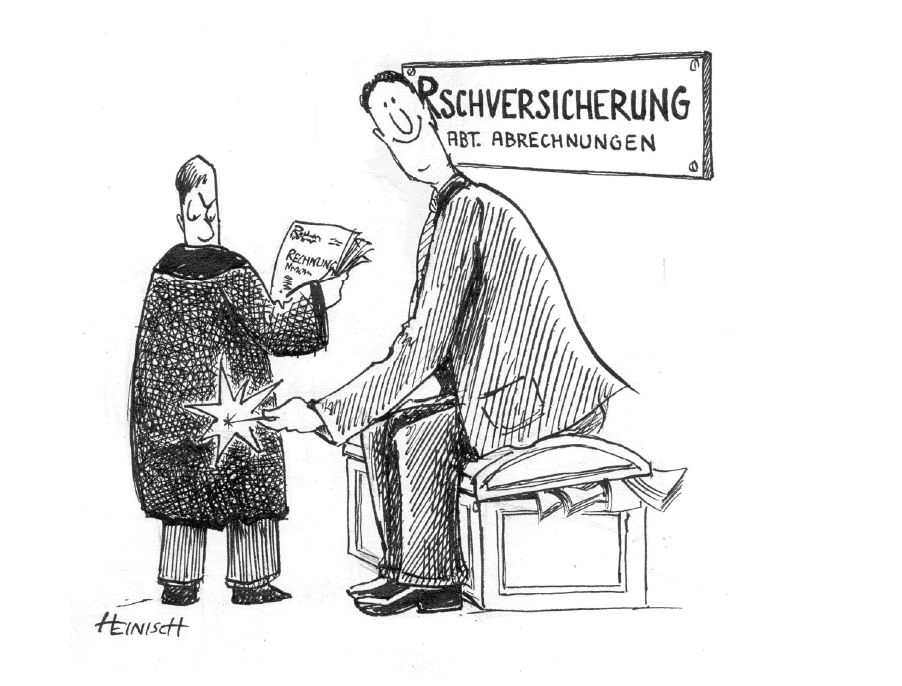
Dass Versicherer nicht selten versuchen, Kostenlasten zu minimieren, ist keine theoretische Befürchtung. Anwälte haben diese Erfahrung längst gemacht. Dokumentiert wurden sie über Jahre im RSV-Blog – Praktische Erfahrungen mit den Leistungen der Rechtsschutzversicherer (bis April 2016 online unter rsv-blog.de).
Einige O-Töne aus der Praxis sprechen eine klare Sprache:
- „Man lässt den Mandanten also alleine mit seiner Entscheidung, entweder nur beschränkt Berufung einzulegen oder aber in vollem Umfang, dann aber jedenfalls teilweise auf eigenes Risiko. Solch eine Rechtsschutzversicherung braucht – keiner!“
- „Die […] sorgt nicht nur für Ärger und Verdruss, wenn sie ihrem Versicherungsnehmer die angemessenen Anwalts-Vergütungen erstatten soll. Vermehrt mischt sie sich auch in das Mandatsverhältnis ein uns erteilt dem Rechtsanwalt des Versicherungsnehmers konkrete Anweisungen, was er zu hat und wie er es zu tun hat.“
- „Nicht nur im Bereich Verkehrsrecht und Strafrecht erweist sich die […] als ein Versicherer, der sich bei qualifizierten Rechtsanwälten unbeliebt macht. Auch Versicherungsnehmer, die im Zusammenhang mit einem Problem im Arbeitsrecht eine Police der […] vorlegen, müssen damit rechnen, auf Kosten sitzen zu bleiben, gegen die sie sich eigentlich versichert und wofür sie teure Prämien an die […] gezahlt hatten.“
Diese Erfahrungen sind kein nostalgisches Echo aus der Vergangenheit, sondern eine Mahnung für die Zukunft. Wer jetzt den Versicherern mehr Befugnisse zur außergerichtlichen Vertretung einräumt, darf sich nicht wundern, wenn diese Tendenzen systematisch verstärkt werden.
Aktives Schadensmanagement auf Kosten des Verbrauchers
Rechtsanwalt Joachim Cornelius-Winkler, einer der profundesten Kenner der Rechtsschutzversicherung, hat wiederholt die Tendenzen des sogenannten „aktiven Schadensmanagements“ scharf kritisiert. Sein Befund ist eindeutig:
Das Ziel der Rechtsschutzversicherer ist es im Kern, die Übernahme von Anwalts- und Gerichtskosten durch eigene Maßnahmen – etwa telefonische Beratungshotlines oder die Steuerung hin zu sogenannten Vertrauensanwälten – zu verhindern oder zumindest zu minimieren.
Diese Einschätzung bringt das Dilemma auf den Punkt: Verbraucherinnen und Verbraucher sollen glauben, sie bekämen „Recht aus einer Hand“. In Wahrheit wird ihnen der Zugang zum unabhängigen Rechtsanwalt defacto erschwert – genau jener Instanz, die die Durchsetzung ihrer Rechte ohne Rücksicht auf Kostenerwägungen garantiert. Rechtsanwälte werden nahezu ausgegrenzt, weil der Rechtsschutzversicherer in weiten Teilen im Besitz der Kundenschnittstelle ist und Kundenströme nach Belieben lenkt.
Rechtsschutzversicherer haben in den letzten Jahren ein immer ausgefeilteres Regulierungsverhalten entwickelt. Der Verbraucher merkt davon oft wenig, aber für Anwälte ist klar: Hier wird gesteuert, gelenkt und auch gebremst. Das Verhältnis zwischen Versicherung, Mandant und Anwalt ist längst kein Dreiecksverhältnis mehr, sondern ein Machtspiel, in dem die Versicherung die stärkste Position beansprucht.
Es handelt sich nicht um die pauschale Abwehrhaltung einer Berufsgruppe, sondern um ein systemisches Problem. Rechtsschutzversicherer sind längst zu aktiven Marktakteuren geworden, die tief in die Mechanik der Rechtsdurchsetzung eingreifen. Oft fühlen sich Verbraucher durch das Regulierungsverhalten einiger Rechtsschutzversicherer im Stich gelassen.
Die europäische Dimension: Das Halmer-Urteil des EuGH
Besondere Bedeutung erhält die Diskussion durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 19. Dezember 2024 in der Rechtssache Halmer (C-295/23). Im Kern ging es um das Fremdbesitzverbot bei Anwaltsgesellschaften. Der EuGH bestätigte, dass Beschränkungen, die die Unabhängigkeit der Anwaltschaft sichern sollen, unionsrechtlich zulässig und sogar erforderlich sein können.
Drei Punkte sind für die aktuelle Debatte besonders bedeutsam:
- Unabhängigkeit der Rechtsausübung – Der EuGH unterstrich, dass die anwaltliche Unabhängigkeit ein hohes öffentliches Gut ist, das nicht allein den Interessen der Berufsträger dient, sondern die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege sichert.
- Gefahr wirtschaftlicher Einflussnahme – Die Luxemburger Richter betonten, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten die freie anwaltliche Interessenvertretung beeinträchtigen können. Dies gilt im Fremdbesitz-Fall durch Investoren, lässt sich aber ohne Weiteres auf Rechtsschutzversicherer übertragen, wenn diese Beratung und Vertretung in Eigenregie übernehmen würden.
- Signalwirkung für die Politik – Der EuGH machte klar: Mitgliedstaaten dürfen Schutzmechanismen installieren, um wirtschaftliche Einflussnahmen einzuschränken. Damit stärkt das Urteil die Position all jener, die vor einer Verwischung der Grenze zwischen unabhängiger anwaltlicher Beratung und versicherungsökonomisch motivierter Konfliktsteuerung warnen.
Das Halmer-Urteil wirkt somit wie eine Leitplanke für die nationale Gesetzgebung: Wer die anwaltliche Unabhängigkeit durch zu weitgehende Rechte für Rechtsschutzversicherer aushöhlt, riskiert nicht nur die Qualität der Rechtsdurchsetzung, sondern auch unionsrechtliche Konflikte.
Freie Anwaltswahl nach § 127 VVG – wie die geplante RDG-Reform diesen Grundsatz konterkarieren würde
§ 127 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) lautet in Abs. 1 wie folgt: „Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, im Versicherungsfall den Rechtsanwalt seines Vertrauens zu beauftragen.“ Dieser Grundsatz gilt als tragendes Fundament des Rechtsschutzsystems in Deutschland.
Rechtsschutzversicherer erhalten nach der Beschlussvorlage das Recht, selbst außergerichtliche Rechtsdienstleistungen anzubieten. Der Versicherungsnehmer wird dann – zumindest psychologisch – dazu gedrängt, die „hauseigene“ Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen, statt frei einen unabhängigen Anwalt zu wählen. De-facto-Steuerung durch „Soft Pressure“ dürften sich weiter etablieren. Formell bleibt § 127 VVG zwar bestehen, faktisch wird die freie Wahl ausgehöhlt, weil Abweichungen mit Nachteilen (Kosten, Verzögerungen, Verweigerung von Serviceleistungen) verbunden sein können. Die geplante Öffnung schafft hierfür einen rechtlichen Freifahrtschein, der § 127 VVG in der Praxis zur bloßen Leerformel machen würde.
Die Beschlussvorlage konterkariert § 127 VVG nicht durch offene Abschaffung, sondern durch schleichende Entwertung. Das Gesetz garantiert die freie Wahl des Anwalts, die geplante Reform sorgt jedoch dafür, dass diese Wahl für viele Versicherungsnehmer praktisch bedeutungslos wird.
Das ist eine gefährliche Entwicklung: Was in § 127 VVG als unveräußerliches Recht des Verbrauchers ausgestaltet ist, würde im Ergebnis durch ökonomische Steuerung und Eigeninteressen der Versicherer ausgehöhlt – ein klarer Widerspruch zum gesetzgeberischen Schutzzweck.
Warum so viele Beschwerden beim Ombudsmann und der BaFin?
Einen weiteren wichtigen Aspekt beleuchtet Rechtsanwalt Dr. Tim Horacek. Er weist in dem Fachmagazin für Risiko- und Kapitalmanagement, Ass Compact im Jahr 2024 – darauf hin, dass rund ein Fünftel aller Beschwerden beim Ombudsmann auf die Sparte Rechtsschutzversicherung entfällt – ein bemerkenswerter Wert, wenn man bedenkt, dass der Marktanteil von RSV im Versicherungswesen deutlich kleiner ist. „Im Kontext von Rechtsschutzversicherungen sind oft drei Parteien mit jeweils eigenen Interessen involviert: der Versicherungsnehmer, der Versicherer und der Rechtsanwalt. Letzterer hat ein starkes Eigeninteresse an einem positiven Schiedsspruch, obwohl er kein Vertragspartner ist.“ betont Dr. Horacek.
Hinzu komme eine wachsende Kluft zwischen Versicherern und der Anwaltschaft: Manche Kanzleien berichten von einem regelrechten Misstrauen seitens der Versicherer, das sich in einer strukturellen Versagung des Deckungsschutzes zeige. In bestimmten Themengebieten oder gegenüber bestimmten Kanzleien werde die Deckungszusage trotz Vorliegen der Voraussetzungen verweigert – oder es würden einzelne Kanzleien trotz grundsätzlicher Deckungszusage ausgeschlossen.
Die Folge: „Nicht selten rät der Anwalt dem Versicherungsnehmer dann zur Einleitung eines Schlichtungsverfahrens“, so Horacek. Für den Verbraucher bedeutet dies zusätzliche Unsicherheit, Verzögerung und ein weiteres Abhängigkeitsverhältnis.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat im Jahr 2024 insgesamt 420 Beschwerden gegen Rechtsschutzversicherer zu verzeichnen gehabt. Im Jahr 2023 waren es noch 361 Beschwerden. Damit ist die Anzahl der Beschwerden ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen, berichtet der Versicherungsbote am 1.7.2025 und führt aus: „Zu beachten ist, dass es weitere Möglichkeiten für die Versicherten gibt, ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen: Der Versicherungsombudsmann zählte im Jahr 2024 rund 2.950 Eingaben, auch die Verbraucherzentralen nehmen Beschwerden entgegen. Es fehlen zudem statistische Zahlen, wie oft Versicherte vor Gericht gegen ihren Versicherer vorgehen – unabhängig von der Sparte. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Beschwerdezahl auf eine große Zahl zufriedener Verbraucher hindeutet.“
Verbraucherrechte auf der Rutschbahn
Die Befürworter der Reform argumentieren, auch Anwälte hätten wirtschaftliche Interessen. Das ist richtig, aber verkürzt. Denn Anwälte leben von ihrer Reputation und dem Erfolg, die Interessen ihrer Mandanten durchzusetzen. Versicherer hingegen leben von der Reduktion ihrer Leistungspflichten.
Ein Versicherungsjurist, der zugleich Kostenträger und Berater ist, gleicht einem Schiedsrichter, der für eine der beiden Mannschaften spielt. Für die Versicherten bedeutet dies nicht „niedrigschwelligen Zugang zum Recht“, sondern eine Abwärtsspirale des Schutzniveaus.
Europäische Vergleiche – Scheinargumente ohne Tiefenschärfe
Dass in Ländern wie Österreich, den Niederlanden oder Skandinavien ähnliche Modelle existieren, wird gern als Kronzeuge angeführt. Doch weder Justizsystem noch Marktbedingungen sind 1:1 auf Deutschland übertragbar. Und die Behauptung, „Missstände seien nicht bekannt“, ist kein Beweis für Funktionalität, sondern Ausdruck mangelnder Transparenz.
Rechtsstaat zum Spartarif?
Die Vision der Versicherer, als „Gatekeeper“ die Gerichte zu entlasten, klingt modern, verkennt jedoch den Kern des Rechtsstaats. Konflikte sollen nicht primär im betriebswirtschaftlichen Kalkül eines Konzerns „beigelegt“ werden, sondern in einem rechtsstaatlichen Verfahren, getragen von unabhängigen Vertretern der Parteien.
Die geplante Reform würde zu einem Rechtsstaat zum Spartarif führen: bequem, billig, aber mit hohem Preis für den Verbraucherschutz. Die Politik ist gut beraten, den Verlockungen der „One-Stop-Lösung“ aus einer Hand nicht unreflektiert nachzugeben. Der EuGH hat mit Halmer eindrücklich gezeigt, dass die Wahrung anwaltlicher Unabhängigkeit Vorrang hat. Die Erfahrungen aus Praxis, Ombudsmann und RSV-Blog liefern die empirische Grundlage, warum eine vorschnelle Öffnung des RDG mehr Gefahren als Chancen birgt.
Die Pressesprecherin der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz in Berlin wollte zur Sache keine Stellungnahme abgeben und teilte am 15.10.2025 folgendes mit: „Da der betreffende Antrag im Rahmen der kommenden Justizministerkonferenz zur Beratung ansteht und die Bewertung derzeit noch geprüft wird, bitten wir um Verständnis, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft erteilt werden kann.“ Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelte am 12.10.2025: Sind Versicherer die Anwälte von morgen? Die Berliner Rechtsanwaltskammer gab gemeinsam mit dem Berliner Anwaltsverein e.V. eine umfassende Stellungnahme gegenüber der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz ab und führte u.a. aus: „Nach Wertung des Vorstands der Rechtsanwaltskammer Berlin und des Vorstands des Berliner Anwaltsvereins greifen Rechtsschutzversicherungen schon seit längerem durch Vermittlungsplattformen und Legal-Tech-Unternehmen in den Rechtsmarkt ein. Dies erfolgt nicht aus Gründen des Verbraucherschutzes, sondern ausschließlich aus wirtschaftlichen Interessen. […] „Statt die Regelung des § 4 RDG aufzuweichen, sollte man nach unserer Ansicht vielmehr darüber nachdenken, die bestehenden Regelung (insbesondere § 127 WG) zu verschärfen.“
Fazit: Kein Experimentierfeld für Konzerninteressen
Die Anwaltschaft muss diesem Vorstoß entschieden entgegentreten. Rechtspflege ist kein Feld für Kostendämpfungsexperimente. Wer einen verbesserten Zugang zum Recht will, muss anwaltliche Beratung fördern, digitale Strukturen ausbauen und Verbraucherbildung stärken.
FAQ: Rechtsschutzversicherer, Rechtsdienstleistungsgesetz und die freie Anwaltswahl
1. Was sieht die Beschlussvorlage der Justizministerkonferenz 2025 vor?
Die Justizministerinnen und Justizminister schlagen vor, das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) zu ändern. Ziel ist es, Rechtsschutzversicherern unter bestimmten Voraussetzungen zu erlauben, außergerichtliche Rechtsberatung und Vertretung für ihre Versicherungsnehmer zu übernehmen.
2. Warum ist das Vorhaben politisch so umstritten?
Befürworter sehen einen niedrigschwelligen Zugang zum Recht und eine Entlastung der Justiz. Kritiker warnen vor Interessenkonflikten, Qualitätsverlusten und der Aushöhlung der anwaltlichen Unabhängigkeit.
3. Was sind die Hauptprobleme, wenn Versicherer selbst Rechtsdienstleistungen erbringen?
- Interessenkonflikte zwischen Versicherer Interessen und Mandanteninteressen
- Gefährdung der anwaltlichen Unabhängigkeit
- Aushöhlung der freien Anwaltswahl (§ 127 VVG)
- Qualitätsrisiken durch standardisierte, kostenorientierte Verfahren
4. Was sagt § 127 VVG zur freien Anwaltswahl?
§ 127 VVG garantiert: „Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, im Versicherungsfall den Rechtsanwalt seines Vertrauens zu beauftragen.“
Die geplante Reform würde dieses Recht faktisch unterlaufen, weil Versicherer ihre Versicherten in Richtung hauseigener Beratungsangebote steuern könnten.
5. Welche Rolle spielt das Halmer-Urteil des EuGH?
Der EuGH bestätigte im Halmer-Urteil vom 19.12.2024, C-295/23, das Fremdbesitzverbot für Anwaltsgesellschaften, um anwaltliche Unabhängigkeit zu schützen. Die Parallele: Auch Rechtsschutzversicherer dürfen nicht in eine Position gelangen, in der sie die anwaltliche Tätigkeit durch wirtschaftliche Interessen steuern.
6. Welche Erfahrungen gibt es mit dem Verhalten von Rechtsschutzversicherern?
Der RSV-Blog (2008–2016) dokumentierte zahlreiche Fälle problematischer Regulierungspraxis, etwa:
„Man lässt den Mandanten also allein mit seiner Entscheidung, entweder nur beschränkt Berufung einzulegen oder aber in vollem Umfang, dann aber jedenfalls teilweise auf eigenes Risiko. Solche Rechtsschutzversicherung braucht – keiner!“
8. Warum gibt es so viele Beschwerden beim Ombudsmann in der Sparte Rechtsschutz?
Laut Dr. Tim Horacek liegt es an der Konstellation von drei Parteien mit eigenen Interessen: Versicherungsnehmer, Versicherer und Anwalt. Konflikte entstehen durch Deckungsverweigerung, Kanzleiausschlüsse und Misstrauen zwischen Anwaltschaft und Versicherern.
9. Welche Folgen hätte die Reform für Verbraucher?
- Einschränkung der freien Anwaltswahl
- Risiko einseitiger, kostenorientierter Beratung
- Zunahme von Konflikten über Deckungsschutz
- Stärkung der Versicherer gegenüber Rechtsuchenden
10. Welche Folgen hätte die Reform für Anwaltschaft und Justiz?
- Anwaltschaft: Gefahr der Marginalisierung unabhängiger Kanzleien
- Justiz: Mögliche Entlastung, aber auf Kosten fairer Rechtsdurchsetzung
11. Welche Alternativen gibt es?
- Stärkung der bestehenden Rechte (z. B. § 127 VVG)
- Mehr Transparenzpflichten für Versicherer
- Förderung unabhängiger Schlichtung statt Versicherer-internem Management
12. Fazit: Warum ist die Reform riskant?
Die Reform droht, die freie Anwaltswahl auszuhöhlen und die Rechtspflege zu ökonomisieren. Recht darf kein Geschäftsmodell der Versicherer werden – das haben Gesetzgeber, EuGH und Praxisberichte klar gezeigt.
*Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht, Fachanwalt für Verkehrsrecht und Fachanwalt für Versicherungsrecht sowie ausgebildeter Mediator in Berlin und gehört dem Vorstand und dem Präsidium der Rechtsanwaltskammer Berlin an.